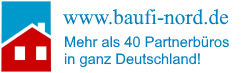Eigenheimzulage
Die Eigenheimzulage war eine staatliche Förderung für den Bau oder Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum in Deutschland. Sie wurde im Jahr 1995 eingeführt und stellte bis Ende 2005 eines der wichtigsten Instrumente zur Wohneigentumsförderung dar. Die Zulage wurde für 8 Jahre gewährt und half vielen privaten Haushalten, den Traum vom eigenen Zuhause zu verwirklichen. Seit dem 1. Januar 2006 ist die Eigenheimzulage ausgelaufen.
Funktionsweise der Eigenheimzulage
Die Eigenheimzulage war eine direkte Steuervergünstigung, die über das Finanzamt beantragt wurde. Sie bestand ab aus folgenden Komponenten:
- Wurde die Wohnung vor dem 1. Januar 2004 angeschafft oder hergestellt, betrug die Eigenheimzulage jährlich 5 % der Herstellungskosten der Wohnung, höchstens 2.556 € für Neubauten bzw. 2,5 % der Anschaffungskosten der Wohnung (höchstens 1.278 € für Altbauten, in beiden Fällen zuzüglich 767 € für jedes Kind)
- Wurde die Wohnung zwischen 1. Januar 2004 und 31. Dezember 2005 angeschafft oder hergestellt, betrug die Eigenheimzulage jährlich 1 % der Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten der Wohnung (höchstens 1.250 €, zuzüglich 800 € für jedes Kind)
Beispielrechnung:
Ein Ehepaar mit zwei Kindern erhielt jährlich:
- 1.250 Euro Grundzulage
- 800 Euro × 2 Kinder = 1.600 Euro Kinderzulage
Gesamt: 2.850 Euro pro Jahr für 8 Jahre, also insgesamt 22.800 Euro Förderung.
Voraussetzungen für die Eigenheimzulage
Um die Eigenheimzulage zu erhalten, mussten folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
- Selbstnutzung:
Die geförderte Immobilie musste selbst genutzt werden, d. h. der Antragsteller musste in der Immobilie wohnen. - Antragsfrist:
Der Antrag auf Eigenheimzulage musste innerhalb von 2 Jahren nach Einzug gestellt werden. - Einkommensgrenzen:
- Für Alleinstehende durfte das zu versteuernde Einkommen 70.000 Euro nicht überschreiten.
- Für Ehepaare lag die Grenze bei 140.000 Euro, zuzüglich 30.000 Euro pro Kind.
- Neubau oder Erwerb:
Gefördert wurden sowohl Neubauten als auch der Kauf von Bestandsimmobilien. Bei Neubauten war das Jahr der Fertigstellung entscheidend.
Einige Banken und Landesförderinstitute haben damals eine Vorfinanzierung der Eigenheimzulage angeboten. Die bestand aus einem Darlehen, das ausschließlich über die jährliche ausgezahlte Eigenheimzulage in den 8 Jahren komplett zurückbezahlt wurde. Damit konnten u.a. die bei einem Immobilienkauf anfallenden Erwerbsnebenkosten bezahlt werden.
Abschaffung der Eigenheimzulage
Die Eigenheimzulage wurde zum 1. Januar 2006 aus folgenden Gründen abgeschafft:
- Kostenexplosion: Die Förderung war für den Staat sehr teuer und belief sich zuletzt auf jährlich ca. 11 Milliarden Euro.
- Ineffizienz: Kritiker bemängelten, dass die Zulage auch Immobilienkäufe gefördert habe, die ohnehin erfolgt wären.
- Geringe Wirkung auf Wohneigentumsquote: Trotz der Förderung blieb die Wohneigentumsquote in Deutschland im europäischen Vergleich relativ niedrig.
Bedeutung der Eigenheimzulage
Trotz ihrer Abschaffung hatte die Eigenheimzulage großen Einfluss:
- Sie förderte den Neubau und Kauf von Wohneigentum und stimulierte damit die Bauwirtschaft.
- Familien mit Kindern profitierten besonders von der Zulage und konnten leichter Wohneigentum erwerben.
- Für viele war sie ein wichtiger Anreiz, langfristig in die eigenen vier Wände zu investieren.
Alternativen zur Eigenheimzulage heute
Auch nach der Abschaffung der Eigenheimzulage gibt es andere Förderinstrumente für Wohneigentum:
- KfW-Förderprogramme: Zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für energieeffizientes Bauen und Sanieren.
- Wohn-Riester: Staatlich geförderte Altersvorsorge für den Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum.
- Regionale Förderungen: Einzelne Bundesländer und Kommunen bieten Programme zur Förderung von Wohneigentum.
Fazit
Die Eigenheimzulage war für fast ein Jahrzehnt ein zentrales Förderinstrument in Deutschland, das vielen Bürgern den Erwerb von Wohneigentum erleichterte. Auch wenn sie heute nicht mehr existiert, bleibt sie ein wichtiges Kapitel in der Geschichte der Immobilienfinanzierung.